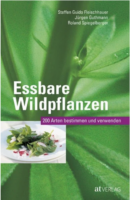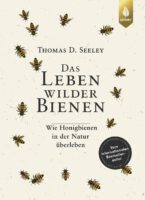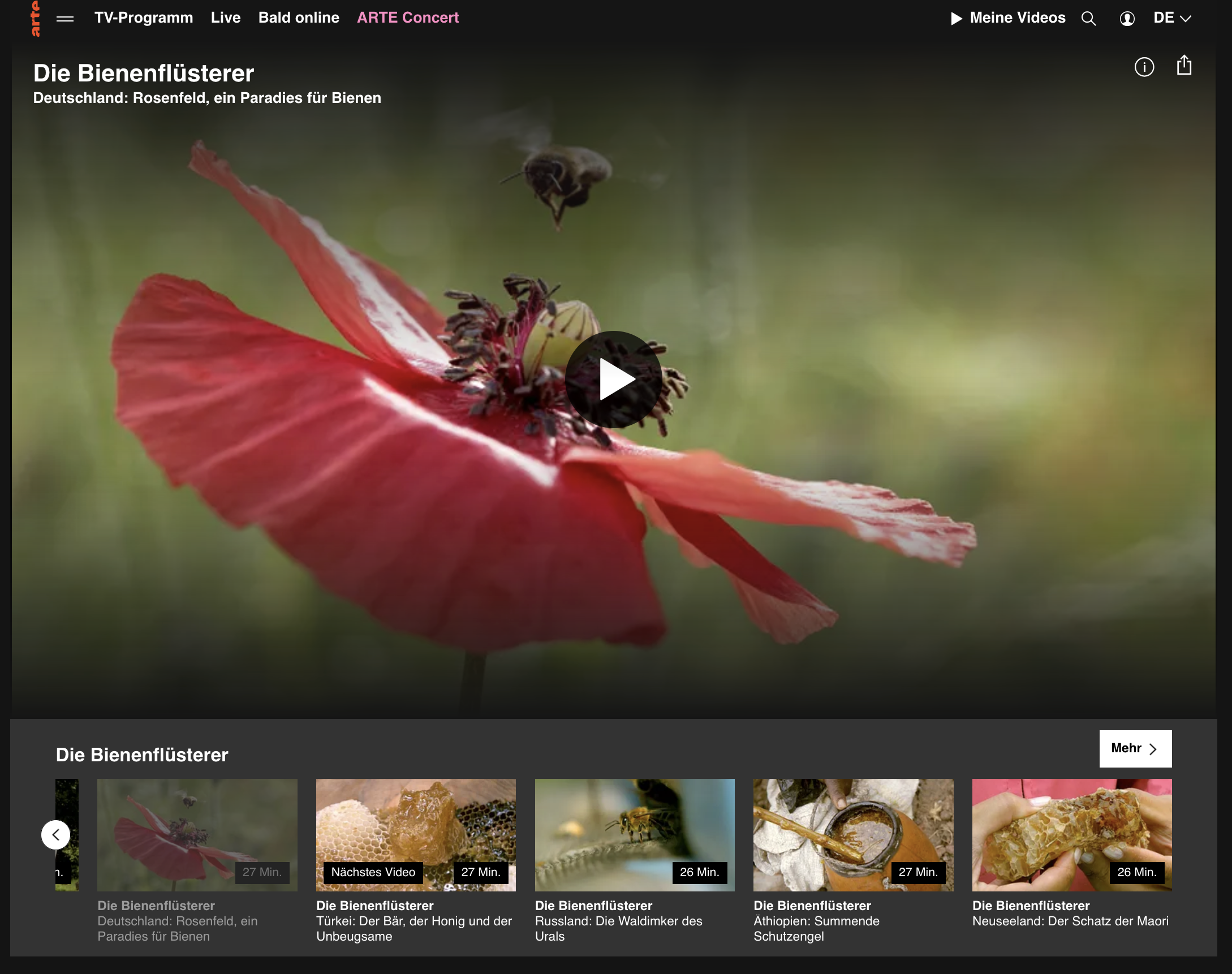Welche Gartenbesitzer in Zeiten der Klimaerwärmung wünscht sich das nicht: „pflegeleicht, trockenheitsresistent und vielfältig“ und möglichst ohne Gießen, so soll „der Garten für die Zukunft“ sein. Anke Clark hat mit dem BLV-Ratgeber Natur-Präriegärten die passende Antwort in Form von Garten- und Pflanzenporträts und ein Kapitel der besten Pflanzen für Schmetterlinge, Wildbienen & Co. Also genau die richtige Lektüre für unser Bienen- und Insektenanliegen hier.
Welche Gartenbesitzer in Zeiten der Klimaerwärmung wünscht sich das nicht: „pflegeleicht, trockenheitsresistent und vielfältig“ und möglichst ohne Gießen, so soll „der Garten für die Zukunft“ sein. Anke Clark hat mit dem BLV-Ratgeber Natur-Präriegärten die passende Antwort in Form von Garten- und Pflanzenporträts und ein Kapitel der besten Pflanzen für Schmetterlinge, Wildbienen & Co. Also genau die richtige Lektüre für unser Bienen- und Insektenanliegen hier.
Weise Worte vorab
Die Autorin beginnt mit einer pragmatischen Beschreibung, warum unser Land neue Gärten benötigt. Klimawandel, dadurch trockene Sommer, verbunden mit Hitzestress, und milde Winter, die Pflanzenschädlingen zum Überleben verhelfen. Das voranschreitende Artensterben in großem Ausmaß benötigt Gegenmaßnahmen. Denn es ist das eine, sich für die Klimakrise zu rüsten, doch das andere, weil nachhaltigere, ist, die Biodiversität wieder herzustellen. Sprich: Unseren Insekten und anderen heimischen Tierarten ein Schlaraffenland zu bieten, um Ökokreisläufe zu sichern.
Was ist eine Prärie?
Wer jetzt Karl May im Kopf hat, hat nicht verkehrt gedacht. Und da kommen sie auch schon ins Bild, die Bisons (S. 27)! Die Prärie (vom Französischen für Weide oder Wiese) ist tatsächlich die nordamerikanisch-typische Ausprägung einer Steppe. Im Grunde Ödland, wie wir sie auch hierzulande auf landwirtschaftlich übernutzten Flächen antreffen.
Seit den frühen 80er Jahren hat sich der „New German Style“ entwickelt. Ähnliche Entwicklungen sind „Dutch Wave“ und „New American Garden“, die allesamt die Verwendung von Stauden propagieren. (Übrigens auch die bevorzugte Bepflanzung in unserem Bamberger Bienengarten im ErBA-Park). In diesem Kapitel „Naturpräriegarten“ werden auch Gehölze und Hecken als nicht zu unterschätzende, wesentliche Bestandteile des Gartens definiert.
Hauptteil Planen und Anlegen
So ziemlich jedwede denkbare Gartennutzung für das Planen und Anlegen wurde bedacht. Die üblichen Ansprüche von beispielsweise normalen, sandigen, trockenen, windreichen, feuchten oder lehmigen Standorten, aber auch Refugien oder Reihenhausgarten … alles dabei.
Nach dem einführenden Teil zur jeweiligen Standortgegebenheit folgen jeweils die Profile der dafür geeigneten Pflanzen, also Zwiebelgewächse, Stauden, Wildstauden, Gräser, Gehölze …außerdem wird in einem (Unter)Kapitel (das zum trockenen Standort gehört), auf Schmetterlinge und deren Raupen eingegangen. In einem weiteren (Unter-)Kapitel (das zum normalen Standort gehört) auf Lang- und Kurzrüssler und es wird beispielhaft die Entstehung eines Präriegartens in Schleswig-Holstein gezeigt (was zum Überthema feuchte Standorte zählt).
Ich hätte diese, sich nicht unbedingt selbsterklärende, Kapitelaufteilung augenfälliger systematisiert. Beim ersten Durchblättern erschloss sich es nicht für mich, warum die Steckbriefe scheinbar wahllos eingestreut waren, zumal alle Kapitel- und Unterkapitel-Überschriften gleich formatiert waren. Auch die verschieden pastellig eingefärbten Hintergründe halfen für den Moment nicht. Das konnte ich erst nachvollziehen, als ich das System durchschaut hatte. Der fragende Blick in das Verzeichnis machte es mir auch nicht leichter. Hier wäre eine dritte Untergliederungsebene praktisch gewesen. Soviel zur einzigen Kritik.
Durchblättern macht Freude
Sei’s drum … das Durchblättern macht Freude und vertreibt gerade jetzt im Winter jeden wolkenbehangenen Tag … Schnee gibt’s ja bei uns im Bamberger Raum praktisch nicht mehr.
Viel eigene Erfahrung, und dabei durchaus der eine oder andere Verlust, lässt die Gartenplanerin mit einfließen. Ebenso wie in unserem Bienengarten „verabschiedeten“ sich übrigens auch Clarks „Mädchenaugen“. Seltsam. Na, dafür entwickelt sich so manche Kümmerling-Pflanze erst mit den Jahren, was ich gleichfalls beobachten konnte, und zwar, als sich die sonst so blühfreudige Herbstannemone nach fünf Jahren plötzlich wild entschloss, gleich mehr als den ihr zugedachten Raum einzunehmen.
Ein Ratgeber also von einer ehrlichen Insiderin. Doch mein Eindruck ist, sie schrieb ihn eher für Fortgeschrittene, indem ihr Lebenswerk (Jahrgang 1945) seinen Niederschlag fand. Beispielsweise wird sich im beschreibenden Text nicht lange mit Trivialnamen aufgehalten, wie das bei Gartenprofis gemeinhin der Fall ist.
Obwohl mir viele botanische Namen inzwischen bekannt sind, muss ich in den Gärtnereien oft mein Handy bemühen, weil konsequent auf „Ausdeutschung“ verzichtet wird. Es ist, als ob man den gemeinen Bürger zu Gartenfachkräften erziehen wolle, was ein wenig herablassend wirkt. Die Autorin macht es jedoch wieder wett mit Zweisprachigkeit bei Pflanzenporträts und Registereinträgen. Womit wir schon beim Anhang wären.
Anhang
Adressen und Bezugsquellen aus überwiegend nord- und mitteldeutschen Landen verraten den Lebensmittelpunkt der in Süderbrarup (Schleswig-Holstein) aufgewachsenen und gebürtigen Flensburgerin, die laut Impressum in Kiel ihre Wirkungsstätte hat. Also mitnichten eine Engländerin, wie es der Name vermuten lässt, doch mindestens mit dem gleichen „Garten-Gen“ ausgestattet, um die man die Inselbewohner fast schon ehrfürchtig beneiden muss.
Ach ja … und unsere sehr gute Bamberger Staudengarten, der Strobler, von der auch wir u. a. unsere Bienengarten-Pflanzen bezogen haben, ist ebenfalls dabei. Das wird dich, Johann, sicherlich freuen. Baumschulen, Rosen und Staudenkulturen Patzelt, Memmelsdorf, hingegen fehlte, aber dafür ist sie jetzt hier zu finden.
Die angeführte Literatur mit 12 Titeln zeigt ihre Vorliebe für Schmetterlinge, was zu den meist überwiegend trockenen Präriegärten gut passt. Aber auch Marie-Luise Kreuter mit ihrem Bio-Garten, die Bibel aller Gartenliebhaber, und Paul Westrich mit seinen „anderen Bienen“, mithin das Standardwerk für Wildbienen, haben es in die übersichtliche Liste geschafft. Da gute Bücher ohnehin immer wieder neu aufgelegt werden, ist der Verzicht auf Jahresangaben verständlich.
Fazit
Ein Ratgeber für erfahrene und anspruchsvolle Gartenliebhaber, die zwar in eine veränderte Klimazukunft sehen (müssen), jedoch ihr ebenso eine Verbesserung angedeihen lassen wollen. Für Neulinge wunderbar zum Durchblättern und zur Inspiration durch viele schöne Fotos geeignet. Wobei der mit einem Dutzend Seiten eher kurze, jedoch fürs Erste ausreichende Praxisteil (S. 163 f), aber auch die beiden ersten Kapitel beim Anfangen helfen sollten. Die restlichen Tipps lassen sich dann ja noch peu a peu im Hauptteil nachlesen. Anke Clarks ‚Natur-Präriegärten‘ hat durchaus das Zeug dazu, unsere Gärten zu revolutionieren.
Clark, Anke: Natur-Präriegärten : der Garten für die Zukunft: pflegeleicht, trockenheitsresistent und vielfältig. 1. Aufl. München : BLV. 2023. 192 S. ISBN 978-3-96747-124-3
Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.