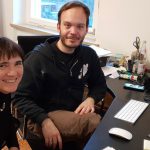Übersicht
 Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) breitet sich seit 2022 rasant in Bayern aus und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Honigbienen, Wildinsekten und in gewissem Maße auch für die Landwirtschaft dar. Bayern ruft für die ersten Juliwochen und auch danach zum Monitoring auf.
Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) breitet sich seit 2022 rasant in Bayern aus und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Honigbienen, Wildinsekten und in gewissem Maße auch für die Landwirtschaft dar. Bayern ruft für die ersten Juliwochen und auch danach zum Monitoring auf.
 Merkmale der Vespa velutina n.
Merkmale der Vespa velutina n.
Die Asiatische Hornisse ist leicht von der heimischen Europäischen Hornisse (Vespa crabro) zu unterscheiden:
- Größe: Königin bis 3 cm, Arbeiterinnen 2–2,5 cm
- Färbung: schwarz mit gelber Binde, orangefarbenes Hinterleibsende, gelbe Beinenden
- Kopf: orangefarbene Vorderseite, schwarze Oberseite
- Nestbau: Meist freihängend in Baumkronen, Eingang seitlich
- Verhalten: Nicht nachtaktiv, sehr territorial in Nestnähe
Neue EU-Klassifizierung: Von „invasiv“ zu „etabliert“
Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, besonders unter Wein- und Obstbauern sowie Imker, wurde die Asiatische Hornisse 2024 von der Liste der invasiven Arten gestrichen, s. a. Deutsches Bienen-Journal.
Das bedeutet, dass EU-weit keine verpflichtende Bekämpfung mehr vorgeschrieben ist. Der Bund hatte nun die Möglichkeit ergriffen, die immensen Kosten auf die Länder abzuwälzen, die diese nun an die Bevölkerung weiterreicht. „Du willst die Vespa velutina bekämpfen? Dann musst du dich selber kümmern.“
Doch auf Landesebene, beispielsweise in Bayern, wird dennoch weiter gehandelt und auch (überregional) geforscht. Dort gilt der Einwanderer weiterhin als meldepflichtig und gefährlich für die heimische Artenvielfalt.
Was können Imker und Bürger tun?
1. Monitoring mit Locktöpfen
Besonders effektiv und daher dringend geboten ist das Aufstellen von Locktöpfen mit einer Mischung aus dunklem Bier, Weißwein und Fruchtsirup. Und so geht’s (hier ausführliche Anleitung):
- Töpfe nur eine Woche stehen lassen
- Monitoring im Juli, August und September
- Falls sich zu viele Honigbienen einfinden, können sie durch einen höheren Alkoholgehalt ferngehalten werden
2. Beobachtungen dokumentieren
- Sichtungen mit Foto an die Meldeplattform beewarned.de
- Flugrichtung beobachten und notieren.
- Aufklärung im Imkerverein betreiben.
 Hierzu gibt es anschauliches Infomaterial vom Institut für Bienenkunde und Imkerei, IBI, der LWG. Auch in kleinen Mengen erhältlich in der Bienen-InfoWabe während der BIWa-Sonntagsöffnungen am 3. So. im Monat von April bis September und auf direkte Anfrage.
Hierzu gibt es anschauliches Infomaterial vom Institut für Bienenkunde und Imkerei, IBI, der LWG. Auch in kleinen Mengen erhältlich in der Bienen-InfoWabe während der BIWa-Sonntagsöffnungen am 3. So. im Monat von April bis September und auf direkte Anfrage.
Nestsuche
Einzelpersonen sollten niemals selbst Nester entfernen! Dafür sind geschulte Fachkräfte notwendig. Für die Suche selbst gibt es Methoden wie:
- Verfolgung mit Locktopf: Tier beobachten, Flugrichtung notieren und Locktöpfe in der Umgebung verteilen.
- Triangulation: Flugrichtungen von mehreren Locktöpfen per Karte auswerten.
- Doppelkreismethode: Rückkehrzeit messen, um Entfernung zum Nest abzuschätzen.
Warum ist Vespa velutina so problematisch?
- Sie bejagen Honigbienen massiv direkt am Flugloch. Dabei kommt es zu einer Bienenparalyse. D. h., die Bienen trauen sich nicht mehr aus dem Stock heraus, das Volk geht in wenigen Tagen ein.
- Gibt es keine leicht zu erbeutenden Honigbienen, sind Wildbienen und andere Insekten, Spinnentiere und Käfer etc. ihre nächsten Fressopfer.
- Bis zu 75 % Fruchtverluste im Obst- und Weinbau sind möglich.
- Das Stichrisiko bei Nestkontakt (insbesondere in urbanen Gebieten) stellt eine Gefahr dar, beispielsweise auch für Landwirtschaftshelfer.
- Verdrängung heimischer Arten durch Konkurrenzdruck.
Wo wurde die Vespa velutina im Umkreis um Bamberg bereits gesichtet?
In Bayern wurden im Jahr 2024 bereits 30 Nester entdeckt. Laut der offiziellen Verbreitungskarte 2024 der Expertengruppe Vespa velutina gibt es keinen bestätigten Nachweis der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) direkt in Bamberg oder im Landkreis Bamberg.
Bamberg wird laut verifizierter Funde aus der Sichtungskarte von beewarned wohl vom Westen und Süden her besiedelt werden. Derzeit nähert sie sich vom Süden und Westen her. Nächste Fundorte sind:
-
Ehe, Neustadt / Aisch
→ Rund 45 km südlich von Bamberg -
Gädheim (Landkreis Haßberge)
→ Nur etwa 30 km westlich von Bamberg
Bei einem jährlichen Verbreitungsradius von bis zu 80 Km ist das, vor allem an einer einfach entlang zu fliegenden freien Fläche wie dem Main, seeeeeehr nahe!
Oberfranken, also Stadt und Landkreis Bamberg, Forchheim, Lichtenfels und Bayreuth, sind weiterhin fundfrei (Stand 2024). Trotzdem ist Wachsamkeit geboten, da sich die Vespa velutina nachweislich jährlich weiter ausbreitet. Frühzeitiges Monitoring kann helfen, erste Einzelfunde schnell zu entdecken und einzudämmen.
Aufruf
Aktuelle Nachweiskarten der verschiedenen Bundesländer belegen eine zunehmende Ausbreitung dieser invasiven Art in Deutschland. Durch gezielte Aufklärung, Monitoring und frühes Eingreifen lassen sich die äußerst negativen Auswirkungen etwas eindämmen, wenn auch nicht völlig verhindern. Jede/r kann mit einer Meldung über beewarned.de zur Schadensbegrenzung beitragen.
„Wichtig ist, dass Vespa velutina kein Imkerproblem ist. Vespa velutina ist ein Gesamtbevölkerungsproblem. Stichverletzungen, Biodiversität…
Für die Imker kommt das Problem erst im Spätjahr.
Aber ohne die Imker ist das Problem nicht zu lösen. Die Imker vor Ort müssen Ansprechpartner für die Bevölkerung sein, sie müssen Tiere am Dochtglas markieren. Die Bevölkerung hilft mit.“
(Zitat Heike Mensch, WhatsApp, Velutina Army, Hauptgruppe. Der Einladungslink für die Gruppe: https://chat.whatsapp.com/Dpjqu1qQwN0KSlTmadYEYv
Der Eintritt in diese Hauptgruppe erfolgt via Beitrittsanfrage und muss von einem Admin frei gegeben werden.)
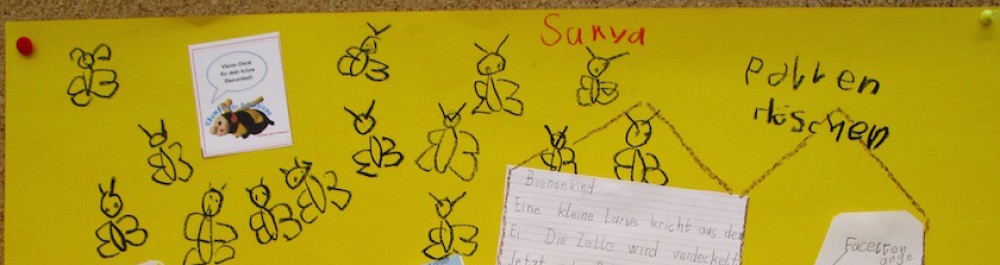



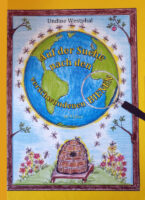



 Für die Imker spricht unsere Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de (Reinhold Burger und Ilona Munique), für die Landwirtschaft
Für die Imker spricht unsere Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de (Reinhold Burger und Ilona Munique), für die Landwirtschaft