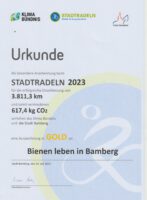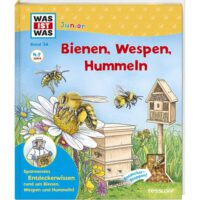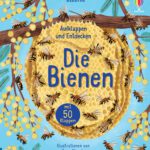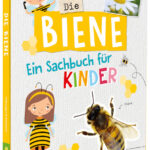[Werbung] „Wildbienen artgerecht unterstützen“ ist das erklärte Ziel des „Ratgebers für die Gartenpraxis“ der Biologin Angela Niebel-Lohman, der es nach Angaben des Haupt Verlags „besonders die Interaktionen zwischen Bienen und Blüten angetan hat“.
 Hauptteil Wildbienen-Artenporträts
Hauptteil Wildbienen-Artenporträts
Dabei geht die Pflanzenwissenschaftlerin in ihren Wildbienen-Artenporträts nach Kalendermonaten vor, beginnend mit dem Februar und endend mit dem September. Systematisch, wie die Wissenschaft nun einmal ist, wird innerhalb der Monate alphabetisch geordnet, selbstverständlich nach dem Anfangsbuchstaben der zoologischen Nomenklatur.
Während für den Februar lediglich die Weiden- oder Auensandbiene aufgeführt ist und auch der September nur mit der Efeu-Seidenbiene aufwarten kann, bietet der März mit 8 Nennungen die meisten Arten. Darunter die mittlerweile auch der allgemeinen Bevölkerung bekannten Rostroten und Gehörnten Mauerbiene.
Insgesamt werden 30 Wildbienenarten beschrieben. Na, eigentlich 60 (plus Verwechselbare plus Kuckuck), denn Männchen und Weibchen unterscheiden sich meist stark voneinander, sowohl im Aussehen als auch im Verhalten. Kennen wir Menschen, gell?!
Hinzu kommen bei jeder Artbeschreibung die entsprechend aufgesuchten Blüten – und das nicht zu knapp! Endlich einmal (auf S. 79) die „Butterblumen“ nebeneinander gestellt zum optischen Vergleich: Scharfer, Wolliger und Kriechender Hahnenfuß, wie die hübschen gelben Blumen aus der Familie der Ranunculus mit Trivialnamen heißen. Und wer begehrt diese Futterpflanze? Es ist die … na?! … genau! … Hahnenfuß-Scherenbiene! Sie ist streng oligolektisch und sammelt ihren Pollen ausschließlich von Hahnenfuß-Gewächsen, wie wir aus ihrem Porträt erfahren.
Okay, ich persönlich erkenne Pflanzenarten leidlich gut, im Gegensatz zu den über 600 europäischen Wildbienenarten. Warum nicht also den Umweg über die Pflanzenwelt gehen und nachsehen, wer diese hauptsächlich heimsucht? Für mich könnte das Buch durchaus botanisch geordnet sein. Wobei es bei manchen Arten doch recht viele Futterpflanzen wären, etwa bei der Polylektikerin „Rostrote Mauerbiene“.
Der „Speisezettel“ dieser unspezialisierten und daher häufig vorkommenden Wildbienenart zählt zunächst die Pflanzenfamilien auf (z. B. Asparagaceae, also Spargelgewächse) und anschließend die Pflanzenart, in unserem Beispiel die Garten-Hyazinthe, die Traubenhyanzinthe oder die Übersehene/Weinbergs-Traubenhyazinthe, mitsamt natürlich ihren botanischen Bezeichnungen. Der jeweils anschließende Absatz „Was man tun kann“ gibt Tipps u. a. zur Anpflanzung.
Doch an sich ist das zugrunde liegende Ordnungsprinzip einerlei. Denn beim Blättern fallen mir die verschiedenen Blüten ohnehin gleich auf, und meist zeigen die zahlreichen klein- wie großformatigen Fotos zugleich eine sie heimsuchende Wildbiene, deren offenkundige Erkennungsmerkmale nach Gemeinsamkeiten und dann geschlechtsspezifisch getrennt beschrieben werden. Logisch, dass bei der großen Vielfalt an Wildbienenarten Verwechslungen vorkommen können, und so erhalten wir Hinweise zu ähnlichen Arten. In fast allen Wildbienenbüchern wie auch in diesem werden die entsprechenden Kuckucksbienen benannt.
Sehr nützlich ist außerdem der phänologische Kalender, der die doch zeitlich immer recht kurzen Auftritte von Männchen und Weibchen zeigt. So ausgerüstet dürfte die Bestimmung unserer deutschen Wildbienenarten zum spannenden Vergnügen werden, wenngleich es auch nicht das Hauptanliegen des Ratgebers ist, wie wir der Einleitung entnehmen können.
Weitere Kapitel (Auswahl)
Die zweiseitige Einleitung erklärt die Intention des Ratgebers und wartet mit ein paar interessanten Erläuterungen auf, beispielsweise, dass es bivoltine Arten gibt, also Wildbienen, die zweimal im Jahr, sprich: mit zwei Generationen die Natur bereichern.
Ebenfalls mit zwei Seiten kurz, doch als ein eigenes Kapitel werden die Ursachen des Insektensterbens erläutert und dabei auch nicht mit knackigen Tipps und Kritik gespart, die da heißen „Änderung der Agrarförderung, durch die der Pestizideintrag reglementiert werden könne“ und dass Baumarkt-Nisthilfen, Samentütchen und Blühstreifen am Feldesrand nur Scheinhilfen wären. Meine Rede …
Am Buchende finden wir neben dem obligatorischen Glossar ein umfangreiches Literatur- und Internetquellenverzeichnis, einem „Who is Who der Wildbienenspezialist*innen“, vom Schweizer Felix Amiet über den Österreicher Pater A. W. Ebmer bis hin zum deutschen Vertreter Paul Westrich, aber auch Honigbienen-Forscher wie Menzel, Seeley und Tautz. Die Autor*innen des Verlags mit Sitz in der Schweiz begreifen in der Regel in Sachen Natur und Umwelt den deutschsprachigen Raum als landesgrenzenüberschreitend, so dass Bücher aus dem Berner Verlag Haupt einen festen Platz – zumindest in unserer Imker-Bibliothek – erobert haben.
Eine umfangreiche Liste wichtiger Pollenfutterpflanzen kann als Einkaufswegweiser verwendet werden. In ihr sind Lebensform (also ob ein- oder zweijährig, Staude oder Baum etc.), Blütenmonat und -farbe, Wuchshöhe und Boden- wie sonstige Ansprüche in Tabellenform aufgelistet, auch hier wieder nach Pflanzenfamilien und innerhalb dieser im Alphabet der botanischen Namen (mit Trivialnamen) geordnet.
Fazit mit einem weinenden Auge
Trotz 50 Medien zu Wildbienen, die unsere rund 280-bändige Imker-Bibliothek mittlerweile besitzt (= 18%), darf dieser Ratgeber von Angela Niebel-Lohmann nicht fehlen. Er überzeugt durch seine praktische Nutzbarkeit für Laien („Wie kann ich Wildbienen unterstützen? Was soll ich pflanzen? Wer tummelt sich auf meinen Pflanzen?“), ohne dabei ins Oberflächliche zu verfallen. Die konzentrierte und sehr anschauliche Auswahl von 30 von über 600 Wildbienenarten ist gezielt auf interessierte Laien gerichtet.
Einzig ist es überaus bedauerlich, dass Niebel-Lohmann von der Haltung von Honigbienen strikt abrät („Es gäbe schon zu viele …“), angeblich, da für Wildbienen nur noch wenig Futter übrig bliebe und sie somit als Konkurrenz gebrandmarkt wurde. Doch …
„Einen natürlichen (oder auch vor Jahrzehnten vorherrschenden, historischen) Nahrungskonkurrenz-Druck zu bestimmen, ist schwierig bis unmöglich.“, so Gratzer & Brodschneider (2023)¹. Und: „Honigbienen können die Pflanzengemeinschaften einer Landschaft verändern. Dies kann positive Effekte auf die Bestäuber-Pflanzen-Netzwerke haben (Aizen et al. 2008), zum Beispiel in Form verbesserter Verfügbarkeit von Nahrungspflanzen für native Bienen.“ Ja, klar, ich zitiere hier einseitig ‚pro Honigbiene‘, doch das darf ruhig das Gegengewicht zur deutlichen Absage der Autorin an die Bienenhaltung bilden.
In der Darstellung dieses Themenaspekts „Honigbiene versus Wildbiene“ fehlen mir also die ansonsten erkennbar wissenschaftsbasierenden Informationen bzw. sind nicht aktuell bzw. einseitig voreilig getroffen. Denn … „Bereits Paini (2004) hat in seinem Review-Artikel einige methodische Mängel bei Studien zur Konkurrenz von Honigbienen und Wildbienen identifiziert, […].
Solange die Beweislage nicht eindeutig ist, sollten Honig- und Wildbienen (und -freunde) nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das bringt die Natur keinen Deut weiter, sondern verhärtet nur unnötig die Fronten. „In dem renommierten wissenschaftlichen Journal „Science“ gab es 2018 ebenfalls einen Diskurs zum Schutz von Wildbestäubern, etwa wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und durchaus widersprüchlich, diskutiert ob eine Einschränkung der Imkerei das Problem lösen könnte (Geldmann & González-Varo 2018, González-Varo & Geldmann 2018, Saunders et al. 2018, Kleijn et al. 2018). Eine für alle gültige Einigung konnte auch diese Diskussion nicht liefern.“
Also, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da er Ratgeber bereits 2022 erschien, der Artikel von Boecking „Die Konkurrenz von Honigbienen und Wildbienen im kritischen Kontext und Lektionen für den deutschsprachigen Raum“ jedoch erst im März 2023, sei der Autorin ihre mängelbewerte Beurteilung und wissenschaftlich derzeit nicht haltbare Absage an die Honigbiene als eindeutig identifizierbare Konkurrentin halbwegs verziehen.
Versöhnliche Worte zum Schluss: Bis auf die S. 30 (!) kann ich – Honigbienen wie Wildbienen- wie Gartenfreundin – den Ratgeber „Wildbienen artgereicht unterstützen“ als „Ratgeber für die Gartenpraxis“ breit empfehlen.
¹Boecking, Otto. „Konkurrenz zwischen Honig-und Wildbienen.“ LAVES–Institut für Bienenkunde, Celle (2013). In: Entomologica Austriaca, Bd. 30, S. 247–285.
Wildbienen artgerecht unterstützen: der Ratgeber für die Gartenpraxis / Niebel-Lohman, Angela. Bern : Haupt. 2022. ISBN 978-3-258-08239-4.
Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.