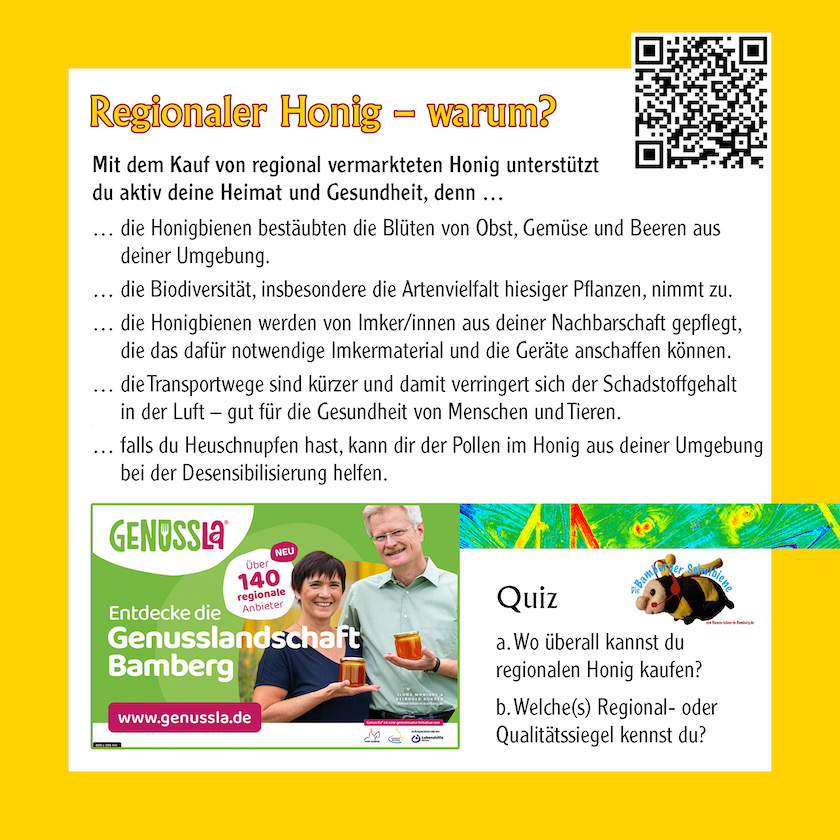Übersicht
1. Das Verfahren des Sublimierens
2. Was ist Oxalsäure?
3. Wann behandeln wir?
4. Equipment und Wirksamkeit
5. Sicherheit und Rechtliches
6. So geht’s
7. Das Verfahren „Träufelbehandlung“

Zum letzten Modul im Fortbildungsjahr 2025 boten wir am 13.12. um 8.30 Uhr im BLIB-Imkerkurses für Anfänger. die Praxis der Oxalsäurebehandlung an. Die Theorie brachten wir in groben Zügen in Kombination mit dem Modul 9 zur Wabenhygiene und Varroabehandlung im August bereits zu Gehör, Daher also im Wesentlichen heute die Praxis zur Sublimieren (Verdampfen).
1. Das Verfahren des Sublimierens
Das Verfahren des Sublimierens durch Erhitzen der kristallinen Oxalsäure(dihydrat), die sodann in einen gasförmigen Zustand übergeht (quasi „verdampft“), gilt als eine sehr bienenschonende und hochwirksame Behandlung gegen die Varroamilbe.
Für Nerds: Der Begriff „Sublimation“ bezeichnet den direkten Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Zustand unter Auslassung einer flüssigen Phase. „Verdampfen“ hingegen bezeichnet den Übergang von flüssig zu gasförmig, was als ein minimaler Unterschied gesehen werden könnte, jedoch in punkto Zulassungsbedingung entscheidend war und ist.
2. Was ist Oxalsäure?
Oxalsäure ist eine organische Säure, wie sie auch im Rhabarber, in schwarzem und grünem Tee und sogar in Schokolade zu finden ist. Sie ist zwar keine „Wellness-Behandlung“ für die Bienen, doch gegen die Varroamilbe hilft sie recht effizient. Richtig angewandt liegt ihr Wirkungsgrad bei über 95%.
Die Oxalsäure wirkt – im Gegensatz zur Ameisensäure – nicht in die verdeckelten Brutzellen hinein. Als Kontaktgift erreicht sie nur die Varroamilben, die auf den Bienen selbst sitzen. Für den Erfolg der Behandlung ist daher die (weitgehende) Brutfreiheit Voraussetzung.
3. Wann behandeln wir?
Spätestens drei Wochen nach den ersten Frösten sind die Völker in der Regel brutfrei, auch, wenn es bis zum Behandlungstermin zwischenzeitlich mal wieder wärmer wurde. Bevor die vor Weihnachten bei uns ziemlich übliche Warmfront einsetzt, sollte die Behandlung erfolgt sein. Denn nach Weihnachten wird’s kritisch. Bereits um die Wintersonnenwende am 21.12. fangen die Bienen oftmals wieder zum Brüten an.
Optimal ist eine Temperaturen von 2°C bis maximal 10°C. Plusgrade sind kein Manko, sofern die Bienen nicht bereits ausfliegen. Am besten wäre es, es bliebe auch ein paar Tage später noch kalt. So kuscheln sich die Bienen zusammen und geben damit die Säure untereinander gut weiter. Seid ihr euch unsicher, dann befragt die Varroawettervorhersage.
4. Equipment und Wirksamkeit beim Sublimieren
Vom Handling her bevorzugen wir den in Ungarn entwickelten und hergestellten InstantVap.



2. Der Varrox Eddy mit Varroxal-Pulver ist zwar ähnlich umstandsfrei, jedoch erscheint uns das Hantieren mit dem kleinen Tiegel (Pulvertöpfchen) – gerade im Winter und mit Handschuhen – weniger praktisch.
 Varroxal unterliegt nicht der Verschreibungspflicht, kann also frei erworben werden. Zulassungsinhaber ist die Firma Andermatt Biovet GmbH. Bei Varroxal handelt es sich um kristallines Oxalsäuredihydrat, das zum Träufeln, Sprühen sowie zur Sublimation, in Imkerkreisen umgangssprachlich als „Verdampfen“ genannt, angewandt werden darf.
Varroxal unterliegt nicht der Verschreibungspflicht, kann also frei erworben werden. Zulassungsinhaber ist die Firma Andermatt Biovet GmbH. Bei Varroxal handelt es sich um kristallines Oxalsäuredihydrat, das zum Träufeln, Sprühen sowie zur Sublimation, in Imkerkreisen umgangssprachlich als „Verdampfen“ genannt, angewandt werden darf.
Voraussetzung für eine gute Wirkung dieser Methode ist natürlich die Brutfreiheit. Oxalsäure wirkt nämlich nicht in die Waben hinein. Somit erreicht sie nicht die in den Brutzellen versteckten Milben, die jedoch die Mehrzahl in einem Volk bilden.
 Varroxal ist standardmäßig ebenfalls für eine einmalige Behandlung im Herbst/Winter vorgesehen. Im Gegensatz Träufelbehandlung mit Oxalsäure ist jedoch eine zweite (oder auch dritte) Behandlung möglich, wird jedoch nur bei stark befallenen Bienenvölkern und bei Völkern mit kleinen Flächen verdeckelter Brut im Winter empfohlen.
Varroxal ist standardmäßig ebenfalls für eine einmalige Behandlung im Herbst/Winter vorgesehen. Im Gegensatz Träufelbehandlung mit Oxalsäure ist jedoch eine zweite (oder auch dritte) Behandlung möglich, wird jedoch nur bei stark befallenen Bienenvölkern und bei Völkern mit kleinen Flächen verdeckelter Brut im Winter empfohlen.
Die Dosierung liegt bei 2 Gramm pro Volk und Anwendung, unabhängig von der Größe des Magazins, der Anzahl Zargen sowie der Bienenmenge.
5. Sicherheit und Rechtliches
Sicherheit
 Zur Sublimation ist eine FFP3-Maske unerlässlich! Beachtet unbedingt die Sicherheitshinweise!
Zur Sublimation ist eine FFP3-Maske unerlässlich! Beachtet unbedingt die Sicherheitshinweise!
Wenn es kalt genug ist, macht den Atemwolkentest: Wohin weht euer Atem? Stellt euch nicht in diese Richtung, denn Oxalsäure kann Lunge und Bronchien stark reizen. Bienen besitzen statt einer Lunge ein Tracheensystem, also ein feines Netz von Luftröhren mit äußeren Öffnungen (Stigmen), über das der Sauerstoff direkt ins Gewebe gelangt. Dadurch reagiert ihr Atmungssystem anders auf Oxalsäure als das des Menschen.
Rechtliches
Seit 28.01.2022 gilt ein neue Tierarzneimittelgesetz (TAMG) und damit die Dokumentationspflicht für die Tiermedikamentation. Buchführung also: Welches Volk wurde wann mit welcher Dosis behandelt inkl. Kassenbeleg des Medikaments.
 6. So geht’s
6. So geht’s
- Alles dabei? Smoker (für den Notfall bei Träufelbehandlung), Verdampfer-Gerät, Oxalsäurepulver, FFP3-Maske, Handschuhe, Wasser zur Reinigung (falls mal was Schief läuft, beim Varrox Eddy zum Kühlen des Tiegels) sowie destilliertes Wasser zur Reinigung der Verdampfungskammer des InstantVap-Geräts.
- Abziehen des Aludeckels des Pulverdöschen, was ohne Handschuhe leichter geht; ggf. Umfüllen in eine praktischere Dose
- Windelkontrolle und Windel wieder einlegen
- Entnahme Fluglochgitter
- Sichere Anbringung des Geräts am Flugloch, ggf. Stein darunterlegen
- Einschalten / Aufheizen des Geräts
- Anziehen von Handschuhen und FFP3-Atemschutzmaske
- Entnahme der Pulvermenge bis zur Markierung am Rohr
- Aufstecken des Rohrs in die Vorrichtung am Gerät
- Wind prüfen und sich außerhalb der Gefahrenrichtung positionieren
- Nach erreichter Temperaturanzeige des Geräts (230°) mehrmaliges Drücken der Dossiervorrichtung
- Sich entfernen aus dem Gefahrenbereich und ein paar Minuten abwarten
- Gerät entfernen und umsichtig reinigen (Kappe mit destilliertem Wasser füllen und Gerättülle weg vom Körper drehen, erst dann Kappe zum Löschen des Restinhalts aufsetzen –> VORSICHT, Dampf entweicht explosionsartig!
- Dokumentieren der Behandlung
7. Das Verfahren „Träufelbehandlung“
Zur Vervollständigung des Themas „Restentmilbung“ hier noch ein paar Infos zur … heute nicht praktizierten (!) Träufelbehandlung.
 Die Temperatur für die Restentmilbung per Träufelbehandlung wäre bei der heutige Temperatur mit 4 °C nicht geeignet gewesen. Lasst euch nicht von Packungsbeilagen irritieren, die eine Behandlungs schon um die 3 °C empfiehlt. Plustemperaturen haben sich als Richtwert sowohl durch verschiedene Studien als auch durch unsere Erfahrungen als ungünstig erwiesen! Denn damit Oxalsäure etwas bewirken kann, müssen die Bienen dicht an dicht sitzen, was sie wirkkich erst bei Minutsgraden tun.
Die Temperatur für die Restentmilbung per Träufelbehandlung wäre bei der heutige Temperatur mit 4 °C nicht geeignet gewesen. Lasst euch nicht von Packungsbeilagen irritieren, die eine Behandlungs schon um die 3 °C empfiehlt. Plustemperaturen haben sich als Richtwert sowohl durch verschiedene Studien als auch durch unsere Erfahrungen als ungünstig erwiesen! Denn damit Oxalsäure etwas bewirken kann, müssen die Bienen dicht an dicht sitzen, was sie wirkkich erst bei Minutsgraden tun.
Das Video zeigt das Vorgehen ausführlich.
ACHTUNG: Die Träufelbehandlung keinesfalls wiederholen! Eine zweite Behandlung verursacht einen stark erhöhten Bienenabgang, was die Überwinterung des Volkes gefährdet. Eine zu geringe Population schafft es nicht mehr, sich warm zu halten.
Literaturtipp: „Führen Sie die winterliche Restentmilbung durch!“ / Infobrief vom 12.12.2022 / Institut für Bienenkunde Celle. (PDF)
Und jetzt – einen enspannten Advent für euch und unsere Bienen, die wir erst wieder im neuen Jahr besuchen werden. Oder auch mal zwischendrin, um den Milbenfall der Behandlung und eventuelle Spechtschäden an den Beuten zu kontrollieren.
Wir freuen uns sehr, dass euch der Kurs gefallen hat und wir wünschen unseren neuen Imkerkolleg(inn)en viel Spaß mit der Imkerei und natürlich immer gesunde Bienen!
 Sa., 07.02.26 – Imkerforum Veitshöchheim
Sa., 07.02.26 – Imkerforum Veitshöchheim