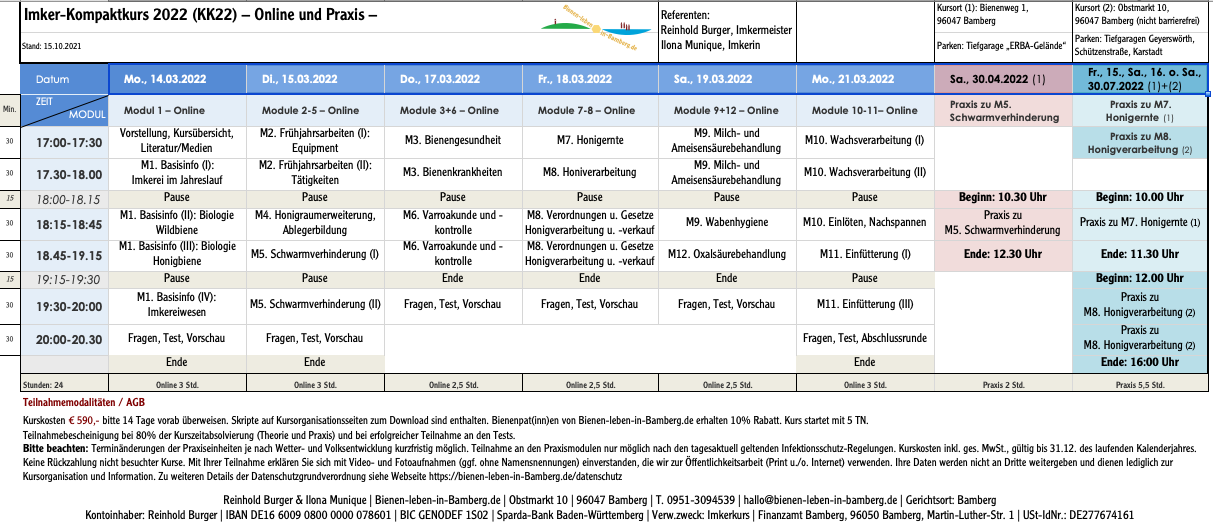Heute am 20. Dezember heißt das Kapitel aus der Vorlesegeschichte „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“:
Heute am 20. Dezember heißt das Kapitel aus der Vorlesegeschichte „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“:
„Das ist doch Betrug!“
„Genau!“, entrüstet sich Miamaria, die aufmerksam zugehört hat. „Ich wollte schon immer mal wissen, warum manche Pflanzen nur so tun, als würden sie uns anlocken. Erst haben wir alle Kraft aufgewendet, um sie zu erreichen, und dann IST DA NIX!!! Kein Nektar, kein Pollen, kein Abendessen … so ein großer Unfug!“; schimpft sie uns.
Die Standpauke hat gesessen. Ich schlucke. Was sollen wir darauf antworten, liebe Kinder und vor allem, liebe Erwachsene?Ich wende mich zerknirscht zu Miamaria hin und sage: „Liebe Miamaria, ich entschuldige mich für die Menschheit, die euch Bienen das Leben so schwer macht!“
Huldvoll nimmt Miamaria meine Entschuldigung an. Ja, sie tröstet mich sogar ein wenig!
Klickt euch einfach um 19 Uhr hier rein: https://meet.jit.si/miamaria-die-weihnachtshonigbiene. Der Chat ist aktiv, ihr könnt also gerne eure Fragen stellen, die wir im Hintergrund beantworten werden.
Oder Ihr könnt das Video auch direkt unter folgendem Link ansehen: https://youtu.be/mujBHvbwkag – Viel Vergnügen!
Aber nur bis zum 21.12. gegen 23 Uhr!