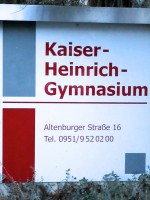Zwar heißt der Videobeitrag von ARD1 „HonigSORTEN im Test“, doch geht es in ihm mehr um den Qualitäts- und Geschmacksvergleich einiger Marken und Abfüller sowie um die Herkunft und den Preis des Honigs im Zusammenhang mit seiner Kennzeichung, weniger um den Vergleich zwischen Sorten wie beispielsweise Waldhonig, Blütenhonig, Rapshonig, Manukahonig, etc. Doch das Fazit der Sendung ist klar: Es gibt deutliche Unterschiede in allen Bereichen. Und die Urteilskraft der Verbraucher ist gefordert.
So wurde festgestellt, dass Bezeichnungen wie „Imkerhonig“ oder Landschaftsbezeichnungen wie „Lüneburger Heide“ in der Abfülleradresse suggerieren, er wäre von hiesigen Imkern eingebracht. Tatsächlich entscheidend ist jedoch die (zumeist kleingedruckte) Ursprungsbezeichnung. Beim „Kaufhaushonig“ findet sich üblicherweise die Angabe: „aus EU und Nicht-EU-Ländern“ und meint damit häufig Osteuropa und Südamerika. Einzig die Bezeichnung „Deutscher Honig“ nebst der aufgedrucken Adresse des Imkers (ist aber nicht unbedingt auch der Imker, der den Honig geerntet hat!) belegen tatsächlich, dass der Honig aus Deutschland kommt, bzw. kommen muss.
Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Marken eingehen, das tut der rund sechsminütige Film bereits. Vielmehr möchte ich den löblichen ARD-Beitrag mit grundsätzlichen Informationen, die mir dort im Hinblick auf die Kennzeichnungen (und damit auf die Verbraucherinformation) zu kurz gekommen sind, nach bestem Wissen und Gewissen ergänzen. Dem heutigen Teil 1 mit Grundinformationen zu Honigrichtlinien folgt morgen dann der Teil 2 mit Tipps, worauf Sie als Verbraucher achten sollten.
Teil 1: Grundinformationen zu Honigrichtlinien
1. Richtlinien der Honigverordnung (HonigV)
Die für Deutschland verbindlichen Richtlinien zur Kennzeichnung von Honig sind in einer Bundesrechtsverordnung festgelegt, und zwar im § 3 der Honigverordnung (HonigV). [Welche „Blüten“ eine Änderung dieser Richtlinien durch die EU-Kommission treiben kann, mögen Interessierte in einem Leserkommentar „Änderung Honigrichtlinie“ nachlesen.]
Dieser Honigverordnung unterliegen lebensmittelrechtlich alle, die Honig in den Verkehr bringen. Mit dem Erlass der Honigverordnung (bzw. seiner Änderung in 2007) unterliegt auch der Honig nun dem Anwendungsbereich der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV).
2. Richtlinien des Deutschen Imkerbund, DIB
Eine weitere, die Honigverordnung strenger auslegende, jedoch nicht im Widerspruch stehende Richtlinie bietet der Deutsche Imkerbund, DIB. Der DIB wirkte sogar, vertreten durch einen Beirat für Honigfragen, im Kommentar zur Honigverordnung mit.
Als Imker/in kann man sich nach den strengeren Vorgaben des DIB richten, muss es jedoch nicht. Es sei denn, der Honig soll in deren speziellen Gläsern abgefüllt und mit deren Gewährsverschluss etikettiert werden. Ein unter dem Markenzeichen des DIB im Umlauf gebrachter Honig erfordert die Beachtung der DIB-Qualitätsrichtlinien.
Um diese speziellen Gläser, die eine erhabene Prägung und ein Siegel aufweisen, und um die Etiketten verwenden zu dürfen, benötigt der Imker den Nachweis eines Honigkurses. Er ist außerdem gezwungen, Mitglied eines Imkervereins zu sein. Der Imkerverein wiederum muss Mitglied des Deutschen Imkerbundes sein, denn der DIB ist ein Institutionenverein.
3. Richtlinien der Bio-Verbände und der EG-Öko-Verordnung*
Grundsätzlich müssen sich die Bio-Verbände ebenfalls an die Honigverordnung und die Kennzeichnungspflicht halten. Da sie das Wort „Bio“ verwenden, zusätzlich an die entsprechenden EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau. Auch ein Imker ohne Öko-Siegel, der seinen Honig als Bio bezeichnet, muss sich diese EU-Vorschriften genauer ansehen und sie befolgen.
Eine Übersicht zu den Richtlinien der Bio-Verbände und deren Ausprägungen verschiedener Bioverbände (Demeter, Bioland, Naturland, Biokreis etc.) mit jeweils der Gegenüberstellung zur EG-Öko-Verordnung* bietet das Buch von Claudia Bentzien: Ökologisch Imkern, Kosmos-Verlag.
* Richtig muss es heißen: EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau, bestehend derzeit aus der EG-Öko-Basisverordnung und zwei Durchführungsverordnungen (EG).
Was das alles für Sie als Verbraucher und geschätzte/r Honigeinkäufer/in bedeutet und worauf wir empfehlen, zu achten, erfahren Sie morgen im Teil 2.
 Mittlerweile ist einiges an Literatur in meinem Ordner „Trachtpflanzen“ aufgelaufen. Hier für euch zum Download und Einkaufen, vielleicht ja noch vor Ostern?
Mittlerweile ist einiges an Literatur in meinem Ordner „Trachtpflanzen“ aufgelaufen. Hier für euch zum Download und Einkaufen, vielleicht ja noch vor Ostern? · Handreichung „Der intelligente Blumenkasten! Bienenfreundlich, insektenfreundlich, küchengeeignet, praktisch“ (PDF) | Wer die PDF hier noch nicht herunterladen möchte, kann direkt auf die LWG-Seite gehen. Dort findet sich der entsprechende Link – neben weiteren Tipps zu Bienen im Garten – ebenfalls: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG, Fachzentrum Bienen
· Handreichung „Der intelligente Blumenkasten! Bienenfreundlich, insektenfreundlich, küchengeeignet, praktisch“ (PDF) | Wer die PDF hier noch nicht herunterladen möchte, kann direkt auf die LWG-Seite gehen. Dort findet sich der entsprechende Link – neben weiteren Tipps zu Bienen im Garten – ebenfalls: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG, Fachzentrum Bienen · Der Blumengarten am Balkon wird bienenfreundlich | Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG
· Der Blumengarten am Balkon wird bienenfreundlich | Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG