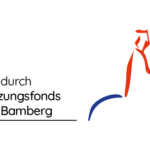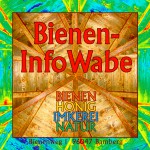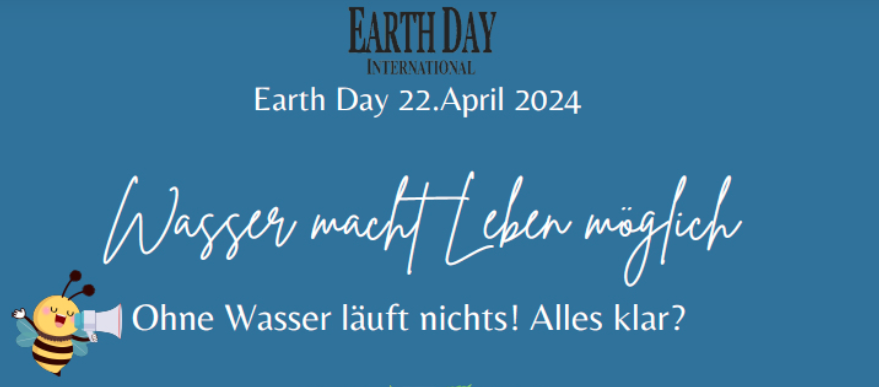Ab jetzt heißt es tatsächlich: „Fühl doch mal!“, wenn die „Integrative Kunst“ in Form von Halbreliefs und Blindenschrift-Tafeln auf kleine und große Bienenbegeisterte trifft. Reibungslos ging die Montage der drei Stelen für Sonnensegel und der beiden Handläufe für den Sinnespfad im Bamberger Bienengarten am 23.05.2024 durch Bildhauer Thomas Gröhling, dessen Tochter Clara und Vinzent Carluccio über die Bühne.
Ab jetzt heißt es tatsächlich: „Fühl doch mal!“, wenn die „Integrative Kunst“ in Form von Halbreliefs und Blindenschrift-Tafeln auf kleine und große Bienenbegeisterte trifft. Reibungslos ging die Montage der drei Stelen für Sonnensegel und der beiden Handläufe für den Sinnespfad im Bamberger Bienengarten am 23.05.2024 durch Bildhauer Thomas Gröhling, dessen Tochter Clara und Vinzent Carluccio über die Bühne.
 Sie hatten den kräftezehrenden Aushub und das Wuchten der schweren Teile fest im Griff und gönnten sich kaum eine Pause. Denn gegen Abend wurden von Fred Morgenroth die noch zu schneidernden Dreieckssegel ausgemessen. Da mussten die Stelen bereits fert verankert, die Teile verschraubt und alles glatt geschliffen sein, auf dass sich niemand verletzen kann.
Sie hatten den kräftezehrenden Aushub und das Wuchten der schweren Teile fest im Griff und gönnten sich kaum eine Pause. Denn gegen Abend wurden von Fred Morgenroth die noch zu schneidernden Dreieckssegel ausgemessen. Da mussten die Stelen bereits fert verankert, die Teile verschraubt und alles glatt geschliffen sein, auf dass sich niemand verletzen kann.
Allen herzlichen Dank für ihren Einsatz!
 Die Schlussrechnung des Bldhauers kann nun erfolgen, die wir Dank der Teilnehmenden der Deutschen Postcode-Lotterie (eine Soziallotterie) und des Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg sofort und vollständig begleichen können. Auch hier unser herzlichster Dank im Namen der sich bereits während des Aufbaus schon sehr interessiert zeigenden Bevölkerung und besonders der zu erwartenden Klassen zum Schulbienenunterricht.
Die Schlussrechnung des Bldhauers kann nun erfolgen, die wir Dank der Teilnehmenden der Deutschen Postcode-Lotterie (eine Soziallotterie) und des Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg sofort und vollständig begleichen können. Auch hier unser herzlichster Dank im Namen der sich bereits während des Aufbaus schon sehr interessiert zeigenden Bevölkerung und besonders der zu erwartenden Klassen zum Schulbienenunterricht.
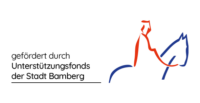 Fehlen nur noch die Sonnensegel … und wer hierzu noch eine (zuwendungsbescheinigte) Spende beitragen möchte … sehr gerne an den FKBB e. V. mit oder ohne Zweckangabe „Bienengarten“.
Fehlen nur noch die Sonnensegel … und wer hierzu noch eine (zuwendungsbescheinigte) Spende beitragen möchte … sehr gerne an den FKBB e. V. mit oder ohne Zweckangabe „Bienengarten“.
 Die Bemalungsaktion wurden die Tage darauf, unterbrochen durch Regen, mit dem 28.05.2024 ebenfalls abgeschlossen. Glücklicherweise bin ich höhensicher, die sechs Meter hohen Stelen waren etwas schwer erreichbar. Jonglierend mit Farbtopf und Pinseln verschiedener Größen hauchte ich den 36 Motiven Leben ein. In der Fotogalerie sind sie alle abgebildet.
Die Bemalungsaktion wurden die Tage darauf, unterbrochen durch Regen, mit dem 28.05.2024 ebenfalls abgeschlossen. Glücklicherweise bin ich höhensicher, die sechs Meter hohen Stelen waren etwas schwer erreichbar. Jonglierend mit Farbtopf und Pinseln verschiedener Größen hauchte ich den 36 Motiven Leben ein. In der Fotogalerie sind sie alle abgebildet.
Fortschrittsberichte:
- 24.03.2024: Projektvorhaben „Fühl doch mal – Integrative Kunst trifft Bienen“ im Bamberger Bienengarten
- 16.04.2024: Projekt „Fühl doch mal! – Integrative Kunst trifft Biene“ schreitet hurtig voran
- 26.04.2024: Projektstart „Kunst trifft Biene“ mit Werkstattbesuch bei Thomas Gröhling
- 28.05.2024: Kunst zum Be-Greifen im Bamberger Bienengarten (dieser Artikel hier)